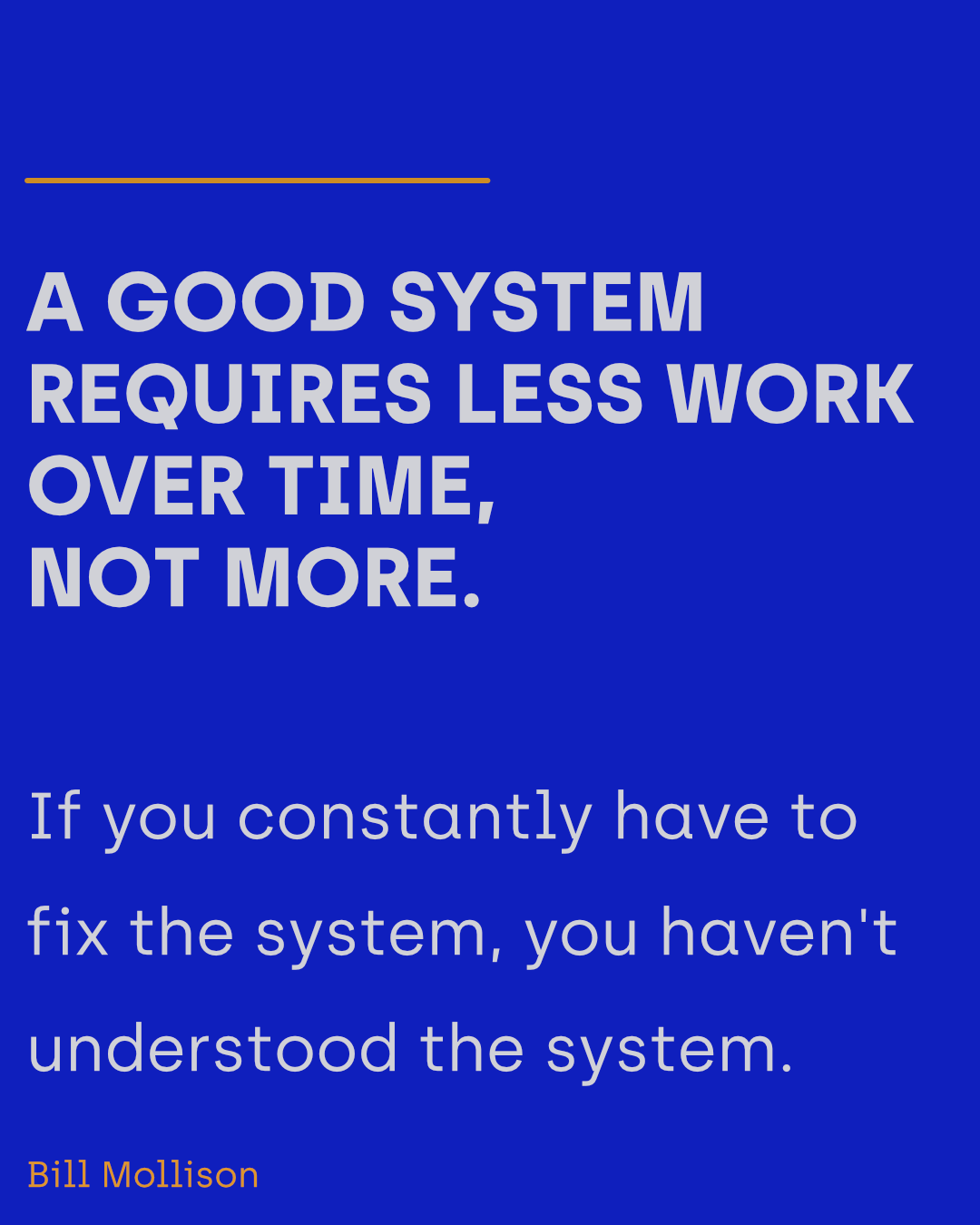Organisationsgestaltung: Die am meisten unterschätzte Aufgabe von Führung?
Strategie ist wichtig. Aber was nützt die beste Strategie, wenn die Organisation nicht in der Lage ist, sie umzusetzen?
Das ist einer der Gründe, warum rund 70 % aller Strategien entweder gar nicht umgesetzt werden oder nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen.
Im vorigen Beitrag habe ich erläutert, warum Organisationen gestaltet ("designed") werden müssen.
Die Organisation eines Unternehmens bestimmt maßgeblich, welche Strategien umsetzbar sind - und welche nicht.
Führungskräfte tragen hier eine große Verantwortung, da sie mit ihren Entscheidungen und Prioritäten das organisatorische Fundament legen, auf dem Umsetzung möglich wird.
Unterschiedliche Strategien erfordern unterschiedliche organisatorische Konfigurationen.
Viele Unternehmen versuchen jedoch, neue Strategien innerhalb bestehender Strukturen und Arbeitsweisen umzusetzen.
Hinzu kommt, dass sich die Strategiezyklen zunehmend verkürzen. Die zentrale Frage lautet nicht mehr, ob ein Unternehmen seine Strategie umsetzen kann, sondern ob es in der Lage ist, gleichzeitig mehrere strategische Optionen zu verfolgen.
Die Antwort darauf hängt von der Organisation ab - genauer gesagt: von ihrer Konfiguration.
In diesem Beitrag erfahren Sie, was Organisationsgestaltung bedeutet, warum sie weit mehr ist als die Arbeit am Organigramm und weshalb sie eine der wichtigsten Aufgaben von Führung ist.
Organisationsgestaltung: Mehr als Arbeit am Organigramm
Organisationsgestaltung ist mehr als das Verschieben von Kästchen im Organigramm oder das bloße Optimieren von Stellenbeschreibungen.
Organisationsgestaltung ist ein systematischer Ansatz, der die bewusste, zukunftsorientierte Arbeit an den formellen und informellen Strukturen einer Organisation umfasst.
Ziel ist es, das Zusammenwirken aller Teile der Organisation so zu gestalten, dass das Unternehmen als Ganzes:
- leistungsfähig ist - als Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg,
- lernfähig bleibt - um kontinuierlich aus Fehlern, Erkenntnissen und Rückmeldungen zu lernen,
- anpassungsfähig wird - um flexibel auf Veränderungen reagieren zu können,
- komplexitätsfähig wird - um konstruktiv mit Komplexität umzugehen,
- und damit zukunftsfähig bleibt - also nicht nur heute, sondern auch in Zukunft wirksam und wettbewerbsfähig ist.
Es geht um die bewusste Gestaltung einer Architektur des Zusammenwirkens.
Organisationen als soziale Systeme verstehen
Organisationen sind soziale Systeme, die entstehen, sobald mehrere Menschen ein gemeinsames Ziel verfolgen.
Je mehr Personen daran beteiligt sind, desto herausfordernder gestalten sich Koordination und Zusammenarbeit und desto wichtiger wird die Rolle von Führungskräften, deren Aufgabe das Schaffen von Rahmenbedingungen ist, in denen Zusammenarbeit gelingt.
Hier eine kleine Auswahl von Fragen, die immer wieder zu intensiven Diskussionen führen:
- Wer macht was? (Arbeitsteilung)
- Welche Rollen werden benötigt? (Job-Architektur)
- Wer entscheidet was? (Entscheidungsbefugnisse)
- Wer koordiniert wen? (Führung)
- Wer braucht welche Informationen? (Kommunikation)
- Wer erhält was? (Kompensation)
- Welche Schnittstellen existieren? Und funktionieren sie? (Zusammenarbeit)
- Welche Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse sind auf welcher Ebene angesiedelt?
- Was wird zentral entschieden, was dezentral? (Hierarchie vs. Autonomie)
Versuchen Sie, Antworten auf diese Fragen für Ihren eigenen Zuständigkeitsbereich zu finden. Sie werden feststellen, dass es alles andere als einfach ist.
Doch genau diese Antworten schaffen die Rahmenbedingungen, in denen Führung und Arbeit einfacher fallen, wodurch Organisationsgestaltung zum strategischen Steuerungsinstrument wird.
Die Herausforderung: sie erfordern Kompromisse und je mehr Bereiche beteiligt sind, desto besser müssen sie aufeinander abgestimmt sein, damit die Organisation als Gesamtsystem funktioniert.
Bewusst gestalten statt vor sich hin organisieren
Viele Unternehmen „organisieren vor sich hin“, ohne sich bewusst Gedanken über ihr Organisationsdesign oder die Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu machen.
Das ist so, als würde man an einem Haus weiterbauen, ohne sich davor den Grundriss anzusehen. Statt mit einem klaren Plan vorzugehen, wird improvisiert - mit allen Folgen für die Menschen, die darin arbeiten.
Egal, ob bewusst gestaltet oder historisch gewachsen. Jedes Unternehmen hat ein bestimmtes Design und funktioniert nach den Prinzipien, nach denen es gestaltet wurde.
Die zentrale Frage für Führungskräfte lautet daher: Passt unser Organisationsdesign noch zur Realität und zu den Herausforderungen, denen wir heute und in Zukunft gegenüberstehen?
Führungskräfte sollten diesen Zustand regelmäßig hinterfragen und überprüfen, bevor strukturelle Probleme die Organisation ausbremsen.
Symptome: Wann ein Redesign ratsam ist
„94% der Probleme in Unternehmen sind systembedingt und nur 6% menschenbedingt.“ W. Edwards Deming
Typische Symptome systembedingter Probleme:
- Verantwortung wird hin- und hergeschoben (Grauzonen)
- Entscheidungen dauern zu lange
- ausufernde Bürokratie
- unklare Rollen und Verantwortlichkeiten
- Teams arbeiten aneinander vorbei
- Teams verfolgen unterschiedliche Ziele (Silodenken)
- an Schnittstellen entstehen Konflikte
- unklare Prioritäten
- zu viele Meetings ohne Mehrwert
- Führungskräfte sind mit operativen Aufgaben überlastet
- unklare oder zu komplizierte Strukturen und Prozesse
All diese Symptome haben ihre Ursache in der Organisation selbst - und genau hier setzt Organisationsgestaltung als wirksamer Ansatz an.
Organisationsgestaltung: Die tragfähige Architektur des Zusammenwirkens
Das Ziel von Organisationsgestaltung ist die bewusste Entwicklung einer tragfähigen Architektur des Zusammenwirkens.
Die Frage nach dem Wohin - also die Ausrichtung und Entwicklung des Unternehmens - wird durch deren Strategie beantwortet.
Organisationsgestaltung hingegen beantwortet die Frage nach dem Wie: Wie wird die Strategie umgesetzt? Dabei spielt das Organisationsdesign eine zentrale Rolle.
Organisationen - ob Team oder Konzern - folgen einem Bauplan, der aus denselben wesentlichen Bausteinen besteht.
Entscheidend für die Wirksamkeit des Organisationsdesigns ist, wie diese Bausteine gestaltet und miteinander vernetzt werden.
Kontextabhängige Organisationsgestaltung: Kein Erfolgsrezept von der Stange
Organisationsgestaltung ist immer von den Rahmenbedingungen - dem jeweiligen Kontext - abhängig, in dem sich die Organisation bewegt. Es gibt daher keine allgemeingültigen Best-Practices oder „das beste“ Organisationsdesign.
Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, sind:
- die Unternehmensstrategie
- der Reifegrad der Organisation
- das Geschäftsmodell
- die Menschen, die in der Organisation arbeiten
- das Umfeld, mit dem die Organisation konfrontiert ist
Holacracy, Selbstorganisation oder agile Prinzipien sind keine Patentrezepte, sondern nur dann sinnvoll, wenn sie zum Kontext und den Bedürfnissen der Organisation passen.
Organisationsgestaltung als kontinuierlicher Prozess
Organisationsgestaltung ist ein kontinuierlicher Prozess, denn Organisationen und ihr Umfeld verändern sich ständig:
- neue Technologien,
- neue Strategien,
- neue Märkte,
- neue Produkte,
- neue Mitarbeitende
- oder neue Herausforderungen.
Mit Organisationsgestaltung entwickelt das Unternehmen eine „Landkarte“ seiner Organisation, die als Orientierungshilfe für zukünftige Entwicklungen dient.
So kann das Organisationsdesign laufend angepasst und fest in der gelebten Praxis verankert werden.
Fazit und Ausblick
Organisationsgestaltung ist kein formelles Pflichtprogramm, sondern ein zentraler Hebel für die Zukunftsfähigkeit jedes Unternehmens. Sie schafft die Grundlage für ein wirksames Zusammenwirken von Mensch und Organisation.
Organisationsgestaltung ist mehr als nur ein Thema von vielen; sie ist eine Kernaufgabe von Führung, die den langfristigen Erfolg und die Anpassungsfähigkeit ihres Unternehmens maßgeblich bestimmt.
Was würden Sie an Ihrer Organisation verändern, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?
Im nächsten Artikel erfahren Sie,
worin sich Organisationsgestaltung und Organisationsentwicklung unterscheiden
und warum diese Unterscheidung wichtig ist.